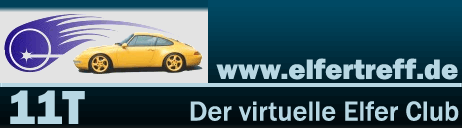 |
|
||||||||||
|
#1
|
|||
|
|||
|
Schöne Würdigung des wahren Weltmeisters...
Viele tolle Bilder und Stories! http://www.focus.de/PF1D/PF1DN/PF1DN...na.htm?id=1619 http://www.rp-online.de/public/article/auto/12845 HEUTE IST ENDGÜLTIG SCHLUSS! Tschüss Käfer  Marcel. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Ich muss auch sagen, daß es schon ein komisches Gefühl ist, wenn heute der letzte Käfer vom Band rollt.
Ich werde nie vergessen, als meine Mutter mich mit ihrem alten Käfer von der Fahrschulprüfung abholte, mir den Schlüssel in die Hand drückte und mich fahren liess. Von da an sauste ich zumindest nachmittags (vor, nach und zwischen irgendwelchen Schulaufgaben mit dem damaligen Käfer meiner Mutter durch Rüsselsheim). Später bekam sie dann noch nen neuen Mexicokäfer, weil sie nichts anderes fahren wollte, der erst vor relativ kurzer Zeit durch nen Polo abgelöst wurde. Dieser grüne Käfer fiel in der Opelstadt nun wirklich bis zum Schluß auf  Ich habe immer gefrozzelt, daß derjenige, der mit nem Käfer unfallfrei bleibt,auch fahren gelernt hat (vorne siehste nix, hinten auch nicht Ich habe immer gefrozzelt, daß derjenige, der mit nem Käfer unfallfrei bleibt,auch fahren gelernt hat (vorne siehste nix, hinten auch nicht  ). Ich hoffe, jetzt meldet sich keine lästernde Stimme, die behauptet, ich hätte das fahren bis heute noch nicht gelernt ). Ich hoffe, jetzt meldet sich keine lästernde Stimme, die behauptet, ich hätte das fahren bis heute noch nicht gelernt   anbei auch noch links mit Bildern und Geschichte : die 70jährige Geschichte des Käfers und einige Bilder
__________________
 
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
achja *seufz*
der gute, lasst ihn uns hegen und pflegen  ich bring auch noch nen link, den ich zwar schon mal gepostet habe, aber er ist es wert: http://www.rallybugs.com/ die verwandschaft auf der rallyepiste 
__________________
... und wieder ein unqualifizierter beitrag vom andreas
  |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Adiós, Vocho, mein Eselchen
Nach 67 Jahren der endgültige Abschied – wenn in Puebla die letzte Serie des VW-Käfer vom Band geht, verliert Mexiko einen wahren Volkswagen Von Peter Burghardt Puebla , im Juli – Der Schlüssel steckt, gleich werden sie ihn wegfahren. Raus auf den Werksparkplatz, wo schon ein paar hundert Exemplare dieser letzten Serie stehen, später auf Lastwagen die 116 Kilometer rauf nach Mexiko-Stadt, vielleicht rüber zum Containerhafen von Veracruz und mit dem Frachtschiff nach irgendwo. Benjamin Perez streicht über die gebogenen Kotflügel und verchromten Scheinwerferfassungen wie ein Stylist über Wangen und Augenlider. Sieht dieses Fahrzeug nicht aus wie ein freundliches, etwas tollpatschiges Lebewesen, das viel Zuneigung braucht? Ein Arbeiter poliert Kratzer und kleine Flecken, Schichtführer Perez kontrolliert das blassblaue Blech, das Spiegelbild zieht sein rundes Gesicht in die Länge. „Er soll perfekt sein“, ruft er, „tadellos.“ Darauf achtet der klein gewachsene Mann im Dienste von VW Mexiko seit 1971, deshalb wird dies für ihn und die übrigen 270 Facharbeiter der Abteilung ein sehr persönlicher Abschied. Seit 32 seiner 49 Lebensjahre arbeitet Perez wochentags von sechs bis drei Uhr an dieser Schöpfung, die bei den Deutschen Käfer heißt, im mexikanischen Prospekt Sedan und bei den Mexikanern Vocho, ein nicht übersetzbarer Kosename für Volkswagen. Als Mechaniker hat er auf diesen 330 Hektar im Norden von Puebla Hunderttausende Trittbretter mit Gummibelag montiert und Hunderttausende Stoßstangen mit Blinker. Er war dabei, als hier am 15. Mai 1981 der weltweit zwanzigmillionste Käfer vom Band ging, bis Ende Juni waren es 21531022. An Ausgang 8 begleitet er jetzt noch 57 Vochos pro Tag. Das schweißt zusammen. „Ich liebe das Auto, es ist mein Leben“, sagt er, und sicher liebt er es noch mehr, seit das Ende der Beziehung naht. Ein paar Gebäude weiter sitzt Thomas Karig in seinem Büro und schaut auf die Autobahn, in deren Morgenstau wie üblich Hunderte von bunten Käfern stecken. „Letzten Endes ist es eine Business-Decision“, sagt der deutsche PR- Direktor der Filiale. Wie Manager das eben so sagen, wenngleich zum Finale auch ihn die Wehmut überkommt. „Irgendwie ist es halt ein nettes Auto, sympathisch“, als Student hatte Karig selbstverständlich ebenfalls einen Käfer. Eine Geschäfts-Entscheidung eben, genauso wie die, 2000 der 14000 Angestellten in Puebla zu entlassen, weil der Gesamtverkauf eingebrochen ist. Getroffen wurde sie weit weg in Wolfsburg, wo die Zentrale bekannt gab, die Produktion ihres berühmtesten und erfolgreichsten Markenartikels in diesem Sommer einzustellen. Es lohnt sich nicht mehr, 2002 wurde VW bloß noch 23 000 Käfer los, 1993 waren es 100000. Das war abzusehen, und überraschend daran ist wohl vor allem, dass es so lange gedauert hat. 67 Jahre. Eine deutsche Geschichte Natürlich ist dies zunächst eine deutsche Geschichte, die Geschichte des Unternehmens VW. „Ich hab’ einen Teil davon gelesen“, sagt Fachmann Perez. Er weiß von Adolf Hitlers Auftrag und Ferdinand Porsches Exposée vom 17. Februar 1936 „betreffend den Bau eines deutschen Volkswagens“. Spezialisten kennen auch Heinrich Nordhoff, mit dem es nach dem Krieg richtig losging.1953 wurden bereits 88 Nationen mit dem Wirtschaftswunderschlitten beliefert, am 17.Februar 1972 übertraf die Nummer 15.007.034 den Weltrekord des Ford T, später bekam der Käfer den Titel „Auto des Jahrhunderts“. Die meisten wussten nicht einmal, dass dieses Ding überhaupt noch hergestellt wird. Das letzte deutsche Stück steht seit 25 Jahren im VW-Museum, es stammt aus Emden, in dessen Hafen 1985 auch die letzten Import-Modelle eintrafen. 1996 war Feierabend in Brasilien. Die globalisierte Technik mit ihren Satellitensystemen und Turbodieseln ist ja längst hinweggeflogen über den eiförmigen Klassiker, obwohl sich die Konstrukteure im Detail alle Mühe gaben. 1972 kam die Panorama-Frontscheibe, 1974 der 1,6-Liter-Motor mit 46 PS, 1981 Halogenscheinwerfer, 1985 Kopfstützen, 1989 die elektronische Zündanlage, 1991 der Katalysator und 1993 sogar eine Einspritzanlage. In den USA wird der alte Beetle nicht mehr zugelassen. In Deutschland bräuchte er unter anderem einen Airbag. Nun soll also auch das letzte Reservat verschwinden, doch die Art hält sich nirgendwo so tapfer wie unter Mexikos Vulkanen. „Der Käfer hat Mexiko motorisiert“, sagt Karig, 1,7 Millionen Vochos wurden hier verkauft, ein wahrer Volkswagen. Billig und robust war gefragt in einer Nation, deren 100 Millionen Einwohner zur Hälfte in Armut leben und über Straßenlöcher hüpfen. Dass das Schlachtross drinnen oft lauter ist als draußen und wahlweise eiskalt oder heiß, dass die Scheiben beschlagen und die Kupplung bockt – weniger wohlhabenden Mexikanern sind solche Kleinigkeiten so egal, wie sie es einst den Nachkriegsdeutschen waren. Der aktuelle Sedan alias Vocho steht mit 77000 Pesos, etwa 6500 Euro, auf der Liste, die Konkurrenten sind teurer. Und komplizierter. „Das ist ein burrito“, sagt Perez, ein Eselchen. Treu, zuverlässig, pflegeleicht und in Ernstfällen Sofortmaßnahmen zugänglich. Die Benzinpumpe lässt sich mit dem Seidenstrumpf abdichten, der Türstöpsel mit dem gebogenen Draht anheben, und Ersatz findet sich an den interessantesten Orten. Ein Taxifahrer berichtet, er habe einmal in der Provinz nach Ersatzteilen gesucht. „In der Apotheke“, hieß es, und da gab es sie tatsächlich. Auch von Notgeburten auf dem Rücksitz wird berichtet. Angeblich wurde der Vocho nach Unwettern schwimmend gesehen. Allein die Taxifahrer! Nur durch die Stadt Mexiko mit ihren 20 Millionen Menschen scheppern 80000 meist grün-weißer Vocho- Droschken. Der Beifahrersitz wurde entfernt, was Gästen das Einsteigen im Fond erleichtert und bisweilen auch Kriminellen, die ihre Kunden in die Mitte nehmen und zum nächsten Geldautomaten befördern lassen. Ältere Baujahre tragen eifrig dazu bei, dem Moloch die Luft zu verpesten, weshalb die linke Stadtverwaltung die Dreckschleudern in Rente schicken will. Für den Erwerb moderner Viertürer zahlt sie Zuschüsse, die Auswahl ist jetzt groß geworden. Der Markt wird überschwemmt, seit Mexiko zur nordamerikanischen Freihandelszone gehört. Bei VW ist inzwischen eine eckige Kiste mit Frontantrieb der Renner, sie heißt Pointer und wird aus Brasilien importiert. So hält die Zukunft Einzug, aber bei Benjamin Perez und seinen Kollegen ist noch manches wie früher. Im Presswerk stanzen noch 1000 Kilogramm schwere Stempel aus dem Hause Weingarten wie 1964 die Vordertüren aus dem Metall. Am trägen Fließband bohren und schrauben unter den Altaren der Jungfrau von Guadalupe noch richtige Menschen. Der vormalige Gouverneur von Puebla hat mal gesagt, in seiner Gegend gebe es zwei Kunsthandwerke: Eine regionale Bastelarbeit und den Vocho. 50 Meter weiter justieren computergesteuerte Roboterarme die Modelle Jetta und den New Beetle, der nur hier gebaut wird, seit 1998 etwa 625000 Mal. Bei der Expo in Hannover stand der Käfer-Enkel im mexikanischen Pavillon und hängt jetzt in mehrfacher Ausführung als neue Galionsfigur am Eingang zum VW-Werk. Schneller, komfortabler. Und viel teurer. Erinnerung, spring an Es ist ein Jammer. Romantiker werden beim Besuch leicht sentimental, es genügt der Geruch von Venyl, das Geräusch der Hupe, das Röhren des Motors. Man erinnert sich an nächtliche Urlaubsfahrten und die Panne hinter Innsbruck, zwei Tage später war ein neuer Vierzylinder installiert, das lohnte sich beim Käfer. Man denkt daran, wie die BMWs im Schneematsch steckten und der Käfer den Berg bezwang. Der Begleiter aus der Werbeabteilung berichtet von der Bitte ehemaliger VW-Mitarbeiter aus Wolfsburg, sich nochmal hineinzusetzen. „Die erzählen dann ihr ganzes Leben.“ Die abschließende Vocho-Auflage wird an diesem Donnerstag vorgestellt. Sie trägt den Titel „Ultima Edicion“, ist in zwei Farben mit Reminiszenzen wie Weißwandreifen zu haben und trägt unter anderem das Logo von Wolf und Burg auf dem Lenkrad, für das der Designer einst zehn Pfennig pro Ausgabe bekam. Die Nachfrage soll zeigen, wann endgültig Schluss ist, was im günstigen Fall vielleicht doch noch dauert. Wenn er darf, dann wird Benjamin Perez jedenfalls auch den letzten Vocho bis zum Ausgang begleiten. „Wie einen Sohn“, sagt er. Vielleicht gibt er ihm sogar einen Kuss. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
dort heißt er vocho
und anderswo: Aama in Kerala Beetle of Bug in Amerika Bjalla in IJsland Bobble in Denemarken Bocho in Costa Rica Bocho in Mexico Bogár in Hongarije Bolillo in Puerto Rico Broasca in Roemenië Brouk in Tsjechië Buba in Joegoslavië Buba in Kroatië Buba in Macedonië Bubbla in Zweden Carocha in Portugal Cepillo in Dominicaanse Republiek Chäfer in Zwitserland Chrobak in Slovenië Coccinelle in Frankrijk Cuca in Guatemala Cucarachita in Honduras Duiwel in Zuid-Afrika Escarabajo in Chili Escarabajo in Spanje Escarabat in Catalonië Escaravello in Galicia Fusca in Brazilië Garbus in Polen Gin-Kwe in Taiwan Hanfusa in Noorwegen Kabutomushi in Japan Käfer in Duitsland Kereta Kura-Kura in Maleisië Kever in Nederland Kodok in Indonesië Kupla in Finland Maggiolino in Italië Pagong in Filippijnen Pichirilo in Ecuador Pornikas in Estonia Skaraveos in Griekenland Vabalas in Litouwen Vosvos in Turkije
__________________
... und wieder ein unqualifizierter beitrag vom andreas
  |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Klasse!
Wo hast du das denn her? 4-Zylinder Grüsse, Marcel. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
@marcel
google machts möglich: http://www.ploon.nl/lvwcn.com/forum/messages/73.html ich hatt schon mal so eine übersicht, find den alten link nimmer.
__________________
... und wieder ein unqualifizierter beitrag vom andreas
  |
|
#8
|
|||
|
|||
   schniiiiiiiieeeef schniiiiiiiieeeef    lange nix mehr so trauriges gelesen Gruß, Henning - der gerade mal die Karosse seine 70'er Clementine angeguckt hat, die seit Jahren auf dem Hof rumgammelt und sich fragt, ob sie nicht vielleicht doch noch 'ne Chance verdient hat?!? 
__________________
a = F / m |
|
#9
|
||||
|
||||
|
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> ob sie nicht vielleicht doch noch 'ne Chance verdient hat [/quote]
aber hallo, erwecke clementine mal wieder schön zu leben! 
__________________
... und wieder ein unqualifizierter beitrag vom andreas
  |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Hallo Zusammen,
toll daß Ihr den Urahn aller Porsches nicht vergessen habt und Ihm einen würdigen Abschied bereitet. Ich habe mich so an den Käfer gewöhnt, daß ich eigentlich davon ausgegangen bin, er würde mich überleben, nun scheint also endgültig der Abschied gekommen, obwohl totgesagte ja bekanntlich länger leben. Damit verläßt uns jetzt also der letzte luftgekühlte mit Heckmotor, schlechthin das ORIGINAL (das niemals durch einen Golf mit "Käferoptik" ersetzt werden kann). Lebwohl Käfer, ich werde dich vermissen. Gruß, Sven (Und nicht nur einer der 21,5 Millionen wird immer bei mir in der Garage stehen)
__________________
"Racing is life ! Anything that happens before or after is just waiting " (Steve McQueen) |
|
#11
|
|||
|
|||
|
HENNING! Laß ihn nicht sterben...!
@Sven: Er wird auch nie in Vergessenheit geraten - dafür verdanken Millionen Menschen ihm einfach zuviel. Und dann sind da ja noch all die schönen Treffen im Jahr...  Werden morgen mit dem hellblauen eine Gedächtnisfahrt machen  Viele Grüsse, Marcel. |
|
#12
|
|||
|
|||
 supportive! ! supportive! ! supportive! ! supportive! ! supportive! ! supportive! ! supportive! ! supportive! ! supportive! ! supportive! ! Von Admin: Die Links wurden auch gelöscht ! Geändert von Stefan917/10 (23.11.2008 um 19:03 Uhr). |
|
#13
|
||||
|
||||
|
...lass es einfach sein!
 |


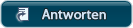





 Linear-Darstellung
Linear-Darstellung

